Homeoffice, Quarantäne, Freistellung, Betriebsschließung.
Das Corona-Virus hat seit dem Auftreten erster Erkrankungen in China (Region Wuhan) Anfang Dezember 2019 und dem ersten Krankheitsfall Ende Januar 2020 in Deutschland inzwischen seit dem 27.02.2020 durch die WHO den offiziellen Status einer Pandemie.
Durch die Ausgangsbeschränkungen und Kontaktsperren- bzw. beschränkungen, Kurzarbeit und weitreichende öffentlich verordnete Betriebs-und Geschäftsschließungen ist das öffentliche Leben zum Stillstand gekommen; ein weitgehender shut down der Wirtschaft ist zu verzeichnen. Es ergeben sich vielgestaltige arbeitsrechtliche Fragestellungen.
Besteht eine Pflicht zur Arbeit im Homeoffice?
Die geltenden Regelungen der Kontaktsperren im Zusammenhang mit den Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Corona-Virus, bedingen, dass die Arbeitsleistungen möglichst von zu Hause erbracht werden sollen. Das Homeoffice ist inzwischen der Standardarbeitsplatz der deutschen Wirtschaft. Vielfach gibt es aktuell Vereinbarungen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, die es ermöglichen ihren Beschäftigten, die Arbeit von Zuhause aus im Homeoffice zu erledigen. Bei Fehlen individualvertraglicher Vereinbarungen oder betrieblicher Regelungen (Betriebsvereinbarungen) gelten folgende Grundsätze:
Ein gesetzlicher Anspruch des Arbeitnehmers, von zu Hause aus zu arbeiten, besteht nicht. Arbeitnehmer können dies jedoch mit ihrem Arbeitgeber vereinbaren. Die bloße Befürchtung, sich bei Verlassen der Wohnung möglicherweise mit dem Corona-Virus anzustecken, ist aus arbeitsrechtlicher Sicht kein Grund, der Arbeit fern bleiben zu dürfen. Denn eine nur potenzielle Ansteckungsgefahr – auf dem Weg zur Arbeit oder am Arbeitsplatz – unterfällt dem allgemeinen Lebensrisiko, das der Arbeitnehmer zu tragen hat.
Eine Option kann sich zudem aus einer Betriebsvereinbarung oder einem Tarifvertrag ergeben.
Eine einseitige Anordnung von Arbeitgeberseite, die Arbeit im Homeoffice zu erbringen ist unzulässig, da kein Anspruch besteht über den Wohn- oder Lebensraum des Arbeitnehmers zu disponieren. Es bedarf somit einer Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Bei Bestehen einer Personalvertretung oder Betriebsrat sind mit diesen Absprachen und Vereinbarungen zu treffen. Bei begründeter Annahme aufgrund von Anhaltspunkten einer Erkrankung an Corona, kann der Arbeitgeber den Arbeitnehmer zum Schutz des Betroffenen und der restlichen Belegschaft zur Genesung nach Hause schicken. Es kann dann keine Arbeitsleistung von zuhause gefordert werden. Bei Arbeitsunfähigkeit besteht insoweit ein Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall (§ 3 EFZG).
Freistellung von der Arbeit, Fernbleiben aufgrund Verdachts oder Infektion
Bei Freistellung von der Arbeit aufgrund bloßer vager Vermutung des Arbeitgebers, der/die Beschäftigte könnte erkranken, befindet sich der Arbeitgeber aufgrund Arbeitsfähigkeit und Arbeitswilligkeit der/des Beschäftigten im Annahmeverzug und schuldet weiterhin Gehalt gemäß § 615 BGB.
Der Corona-Virus kann auch in Betrieben, in denen bislang kein Homeoffice möglich ist, Anlass sein, über entsprechende Regelungen nachzudenken und entsprechende Möglichkeiten zu prüfen, um die Auswirkungen von Ansteckung und Erkrankungen auf den Betrieb zu minimieren. Damit ist hinreichend Anlass gegeben, dass sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer über Arbeit im Homeoffice verständigen und Vereinbarungen treffen.
Die sich intensivierende Pandemie kann dazu zwingen, dass aufgrund der Vorschriften des Infektionsschutzgesetzes die Arbeit in den Betrieben bzw. Arbeitsstätten einzustellen ist. Dann gelten die Regelungen des Infektionsschutzgesetzes.
Hat der Arbeitnehmer den Verdacht, sich mit dem Corona-Virus angesteckt zu haben – etwa weil z. B. Kontakt mit einer Person bestand, bei der eine Infektion festgestellt wurde –oder aus einem Risikogebiet zurückkehrt, in dem gehäufte Infektionsfälle aufgetreten sind, gelten folgende Grundsätze:
Der Arbeitnehmer kann gemäß § 616 S. 1 BGB in Anspruch nehmen, dass ein vorübergehender persönlicher Verhinderungsgrund (§ 616 S.1 BGB) gegeben ist, mit der Folge, dass von der Arbeit fern ferngeblieben werden darf und der Entgeltanspruch gegen den Arbeitgeber unberührt bleibt. Dieser Anwendungsfall ist z.B. gegeben, bei einem medizinisch notwendigen Arzttermin zur Verdachtsabklärung während der Arbeitszeit bzw. dem anschließenden Fernbleiben von der Arbeit wegen der weiteren medizinischen Abklärung. Die unverzügliche Information dieses Arbeitgebers ist in jedem Falle erforderlich für den Anspruchserhalt.
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Krankheitssymptome haben und dadurch arbeitsunfähig sind, haben aufgrund ihrer Arbeitsunfähigkeit das Recht, der Arbeit fernzubleiben. Der Anspruch auf Entgeltfortzahlung besteht nach allgemeinen Grundätzen des EFZG, wie bei krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit aufgrund anderer Erkrankungsursachen. Die allgemeinen gesetzlichen wie ggf. vertraglichen bzw. tariflichen oder durch Betriebsvereinbarung geregelten Vorschriften bezüglich der Meldung der Arbeitsunfähigkeit und deren Nachweis sind einzuhalten.
Betriebsschließung Kurzarbeit Kurzarbeitergeld
Was ist, wenn der Betrieb unter Quarantäne steht oder von Behörden geschlossen wird.
Grundsätzlich tragen die Arbeitgeber auch bei den unerwarteten und von ihnen unverschuldeten Betriebsstörungen, zu denen auch die extern angeordnete Schließung des Betriebes gehört, das Risiko und damit auch die Lohnkosten (§ 615 BGB).
Ein Massenereignis wie die aktuelle Corona-Pandemie stellt aber Betriebe vor bislang nicht bekannte Herausforderungen: Angesichts der aktuell angeordneten, flächendeckenden Schließung von Kultur- und Sporteinrichtungen, Schulen, Kindertagesstätten, Clubs und Kneipen sind für die Sicherung der Löhne und Arbeitsplätzen der dort beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ergänzend zu den geltenden Rechtsgrundsätzen dringend politische Lösungen notwendig, die gewährleisten, dass auch in diesen Fällen die Entgeltansprüche der Beschäftigten gesichert sind..
Das Infektionsschutzgesetz regelt bisher nur für individuelle Arbeitnehmer einen Anspruch gegenüber der zuständigen Behörde auf so genannte Verdienstausfällentschädigung. Dieser gilt für jene Arbeitnehmer, die als „Ausscheider, Ansteckungsverdächtiger, Krankheitsverdächtiger oder als sonstiger Träger von Krankheitserregern“ von der Behörde mit einem beruflichen Tätigkeitsverbot belegt wurden, (§ 56 Infektionsschutzgesetzes (IfSG). Die Entschädigung in Höhe des Verdienstausfalls (in den ersten sechs Wochen) wird vom Arbeitgeber ausgezahlt, § 56 Abs. 5 IfSG.
Der Arbeitgeber hat gegen die Behörde dann einen Erstattungsanspruch hinsichtlich des gezahlten Verdienstausfalls. Damit aber Beschäftigte möglichst lückenlos ihr Geld erhalten, ist der Arbeitgeber insoweit verpflichtet, mit der Entschädigungszahlung in Vorleistung zu gehen – allerdings nur für die Dauer von höchstens sechs Wochen, danach zahlt die Behörde die Entschädigung direkt an die Beschäftigten aus. Falls der Arbeitgeber nicht in Vorleistung geht, zum Beispiel, weil er sich weigert, können sich Beschäftigte mit ihrem Entschädigungsanspruch direkt an das Landesamt/die Landesbehörde wenden.
Was passiert, wenn der Arbeitnehmer persönlich unter Quarantäne steht ohne bereits selbst erkrankt zu sein – etwa in den Fällen von vorherigem Kontakt zu Corona-Infizierten oder Rückkehr aus Risikogebieten?
Grundsätzlich schuldet der Arbeitgeber seinen Beschäftigten weiterhin die Vergütung, wenn sie für eine verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit durch einen in der eigenen Person liegenden Grund ohne eigenes Verschulden an der Dienstleistung gehindert sind (§ 616 S. 1 BGB). Die Rechtsprechung geht hier von einem Zeitraum bis zu von sechs Wochen aus (BGH v. 30.11.1978, III ZR 43/77). Diese Lohnfortzahlungspflicht nach § 616 BGB des Arbeitgebers kann aber durch Tarifvertrag oder Arbeitsvertrag ausgeschlossen oder reduziert werden. Zudem ist umstritten, ob der persönlicher Verhinderungsgrund auch dann greift, wenn der Grund für die Verhinderung eine Epidemie und damit ein außerhalb der persönlichen Sphäre der/des Arbeitnehmers/Arbeitnehmerin liegendes Ereignis ist, das mehrere Personen betrifft. Besteht kein Anspruch auf Vergütungszahlung gegenüber dem Arbeitgeber, greift aber der Entschädigungsanspruch gegenüber dem Staat nach § 56 Abs. 1 IfSG. wie in der letzten Frage beschrieben – der Arbeitgeber tritt hier in Vorleistung, kann aber die Erstattung der Entschädigung bei der zuständigen Behörde beantragen. Zudem gilt auch hier: Beschäftigte, die selbst an Corona erkranken und dadurch arbeitsunfähig sind, erhalten nach den „normalen“ Regeln die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall (EFZG).
Darf der Arbeitgeber dem Betrieb vorübergehend schließen und die Belegschaft „nach Hause“ schicken?
Der Arbeitgeber ist berechtigt, aus freien Stücken den Betrieb vorübergehend zu schließen. Dabei trägt der Arbeitgeber grundsätzlich das Betriebs- und Wirtschaftsrisiko und muss selbst bei unrentabler Beschäftigung die Vergütung fortzahlen (§ 615 BGB) und darf ohne ausdrückliche Vereinbarung auch hier nicht auf die Stundenkonten der Beschäftigten zurückgreifen. Die wirtschaftliche Situation wird aktuell in vielen Fällen die Einführung von Kurzarbeit unter den im Eilverfahren eingeführten geänderten Regelungen zur Kurzarbeit gem. den Vorschriften der § 95 ff SGB III erlauben.

Meine Philosophie, der sich die Kanzlei und die Mitarbeiter verpflichtet fühlen, ist eine stets persönliche, individuelle und hochkompetente Beratung und Betreuung des Mandanten zu gewährleisten, anstatt bloße Sachbearbeitung und schematische Fallbearbeitung abzuliefern.
Rechtsanwalt T. Ullrich Kuttner
Palmaille 108,
22767 Hamburg
Telefon: +49 40 306067 – 0
Telefax: +49 40 306067- 10

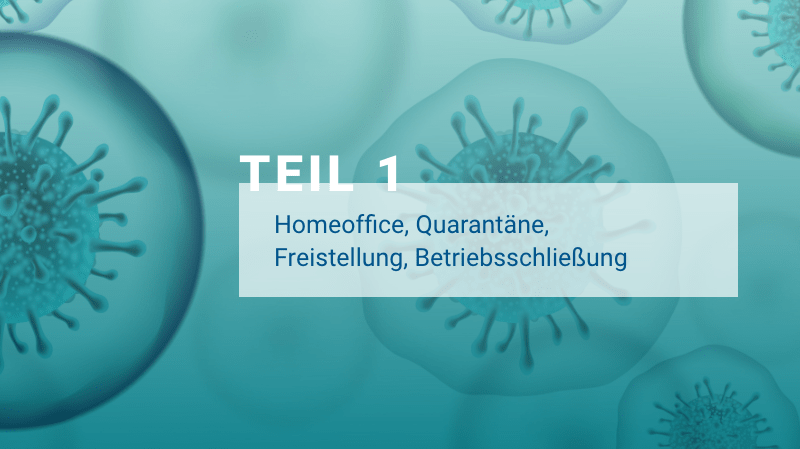
Neueste Kommentare